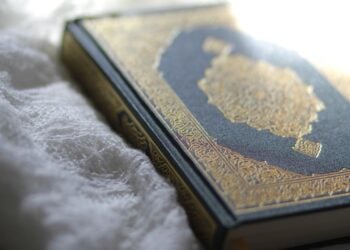Minister Christoffers nimmt Stellung zur aktuellen energiepolitischen Diskussion.
„Die Landesregierung hat bereits vor zwei Jahren eine Diskussion über die zukünftige Aufteilung der wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Energiewende gefordert. In diesem Zusammenhang hat sich die Landesregierung u. a. im Bundesrat dafür eingesetzt, eine bundesweite Umlage für den Ausbau der Stromnetze gesetzlich festzuschreiben. Und sie setzt sich dafür ein, durch den Einsatz neuer Technologien die Kosten im Verteilnetzausbau zu minimieren – um einen industriepolitischen und sozialen Nachteil für die Länder zu verhindern, die beim Einsatz erneuerbarer Energien in der Vergangenheit vorangegangen sind. In der gegenwärtigen Debatte über die Kosten für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien plädiere ich kurzfristig für die Abschaffung der Stromsteuer, um die Energiewende mittelstandsbezogener und sozial verträglicher zu gestalten.
In der grundsätzlichen Debatte über eine Nachfolgeregelung für das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) plädiere ich dafür, dass das System der Umlagefinanzierung ersetzt wird durch eine Überführung in ein gesamtsteuerfinanziertes System. Die gegenwärtige Kopplung von umlagefinanzierten (u. a. KWK-Umlage usw.) und steuerfinanzierten Aspekten (u. a. Mehrwertsteuer und Stromsteuer) ist nicht transparent und findet immer weniger Akzeptanz. Das bringt wirtschaftliche und soziale Ungleichgewichte bei der Finanzierung der Energiewende mit sich.
Die Energiewende wird sowohl Regulierung – also Eingriffe des Staates – als auch marktkonforme Instrumente miteinander verbinden müssen. Die auf Bundesebene geführte Diskussion, das Eine gegen das Andere abzuwägen, ist nicht zielführend, da ein Mix aus Regulierung und Marktkonformität ein zwingendes Erfordernis zur Ausgestaltung der Energiewende ist.
In der Diskussion über die Nachfolgeregelung für das EEG muss darüber hinaus geprüft werden, ob für alle erneuerbaren Energieträger (Wasser, Wind, Sonne, Geothermie und Biogas) der Rahmen eines Gesetzes die günstigste Variante ist oder aber, ob die Entwicklung und industrielle Anwendung so differenziert verläuft, dass jeweils spezifische Regelungen notwendig sind. Das schließt die Entwicklung und industrielle Erprobung und Anwendung von Speichertechnologien ein. Damit könnte eine Anpassung an die unterschiedliche finanzielle und technologische Entwicklung der Energieträger im Zusammenhang mit der Energiewende nachvollzogen und notwendige Transparenz hergestellt werden.
Brandenburg hat mit seiner Energiestrategie 2030 ein realistisches Konzept zur Umsetzung der Energiewende vorgelegt. Ich gehe davon aus, dass das Konzept in eine durch die Bundesregierung angedachte Regionalisierung vollständig einbezogen wird. Die Energiewende bringt eine regionale Veränderung der Erzeugerstandorte mit sich. Aus dem Süden Deutschlands verlagern sich die Schwerpunkte in den Norden. Die daraus resultierenden Interessenkonflikte zwischen den Ländern und zwischen Bund und Ländern dürfen nicht dazu führen, dass jahrelange Investitionen in erneuerbare Energien entwertet werden.
In einer Anschlussregelung muss die Rolle der Kommunen an der Energiewende stärker verankert werden. Brandenburg hat dafür durch regionalisierte Energie- und Klimaschutzkonzepte, die Aufnahme kommunaler Aspekte zur Finanzierung durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) sowie durch die Erstellung eines Leitfadens zu rechtlichen, steuerrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekten kommunaler Beteiligungen an der Energiewende dazu bereits einen Vorschlag unterbreitet. Industriepolitisch muss sichergestellt werden, dass der Zusammenhang zwischen Konversion und EE auch zukünftig erhalten bleiben kann. Das ist kein Brandenburger oder ostdeutsches Problem, sondern aufgrund der Bundesreform ein gesamtdeutsches Problem, um Konversion bezahlbar umsetzen zu können.
Die notwendigen Ausnahmen für stromintensive Unternehmen sind enger mit den Möglichkeiten zur technologischen Entwicklung im Rahmen der Energieeffizienz zu koppeln, um wirtschaftspolitische und soziale Ungleichgewichte zu minimieren.
Um zu verhindern, dass offshore- und onshore-basierte Windenergieanlagen in der Entwicklung gegeneinander gestellt werden, ist es aus finanziellen, ordnungspolitischen und technologischen Gründen notwendig, eine Überprüfung der definierten Ausbauziele vorzunehmen, um einen Interessenausgleich zwischen Bund und Ländern realisieren zu können.
Die dauerhafte Verfügbarkeit von Strom ist in der Öffentlichkeit zu einer unterschätzten Herausforderung geworden. Die dafür notwendigen gesellschaftlichen, technologischen und finanziellen Aufwendungen sind nur z. T. in der öffentlichen Diskussion benannt und bekannt. Die Weiterführung der Energiewende bringt die Chance mit sich, eine transparente Debatte im Entscheidungsprozess über die Gesamtstrategie in Deutschland und deren europäische Einbindung zu führen. Dabei kann es m. E. nicht darum gehen, mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 zu Lösungen zu kommen, deren Wirkungen nicht vorher abgeschätzt werden. Stattdessen gilt es zu Lösungen zu kommen, die in ein Gesamtkonzept von Bund und Ländern einbettet werden.“
Quelle: Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten
Verfassungsschutz stuft AfD Brandenburg „gesichert extremistisch“ ein
Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft die AfD im Land als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. Grundlage ist ein 142 Seiten umfassendes Gutachten,...