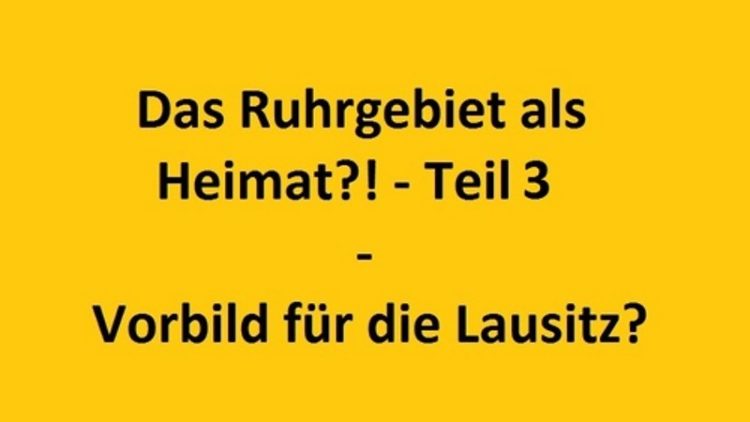Im letzten Teil ging es um den frühen Ruhrbergbau. Nun widmet sich der dritte Teil der industriellen Revolution.
Bereits 1798 wurde die erste Dampfmaschine in der Saline Königsborn bei Unna aufgestellt. Doch erst drei Jahrzehnte später waren die Maschinen leistungsfähig genug, um aus den gewaltigen Tiefen Wasser hochzupumpen.
In diesem Zeitraum gab es viele Industriepioniere, Tüftler und Erfinder, die von den Ideen technischer Innovativen besessen waren. 1803 gelang es dem Schreiner Franz Dinnedahl (1775 – 1826) als Erster eine Dampfmaschine nachzubauen (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.41). Ein wenig später kombinierte er eine Dampfmaschine mit einer Förderpumpe und installierte diese als Wasserhaltungsmaschine in der Zeche Vollmond bei Bochum – Langendreer (vgl. Parent 1991, S.385). 1834 war es dem Unternehmer Franz Haniel mit einer Tiefenbohrung gelungen, die Mergelschicht abzuteufen. Nachdem die Ton – Kalk – Schicht durchdrungen war, konnte Fettkohle abgebaut werden, die wiederum für die Gewinnung von Koks benötigt wurde (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.42). „1847/48 gelang im Ruhrgebiet erstmals die Erzverhüttung auf reiner Koksbasis anstelle von Holzkohle“ (Parent 1991, S.12). Mit der Einführung des Kokshochofens 1849 stieg die Herstellung von Eisen rasant an und es konnte mehr Stahl produziert werden (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.41).
Diese Entwicklung war der Beginn der Verschwisterung von Hüttenwesen und Bergbau, der Schwerindustrie. In der Anfangsphase der Industrialisierung waren erst 12.000 Bergleute tätig (vgl. Tenfelde 2010, S.23). Durch den Bau der Köln – Mindener – Eisenbahnlinie in den 1840er Jahren wurde die Dampflokomotive zum wichtigsten Abnehmer von Kohle und Stahl. Obwohl die Ruhrschifffahrt in den 1850er und 1860er Jahren ihren Höhepunkt mit einer Transportmenge von bis zu 800 000 Tonnen Steinkohle pro Jahr erreichte, wurde sie ab 1873 bedeutungslos (vgl. Parent 2005, S.20f.). Die verkehrsmäßige Erschließung des Reviers und die technischen Neuerungen im herstellenden Bereich führten das Ruhrgebiet in die Phase der Hochindustrialisierung.
Ab den 1850er Jahren folgte eine lange wirtschaftliche Expansionsphase. Zu dieser Zeit herrschte „Goldgräberstimmung“ im Ruhrgebiet. Der Abbau des „Schwarzen Goldes“ wanderte nach Norden, in die Hellweg- und Emscherzone. Das hatte „eine[…] der größten Binnenmigrationen der deutschen Geschichte“ zur Folge (Boldt, Gelhar 2008, S.48). Die Industrieunternehmer warben mit Hilfe von Werbekampagnen aktiv um Arbeitskräfte. Besonders „verarmte Arbeitskräfte aus Agrar- und im Niedergang begriffenen Gewerberegionen“ fühlten sich angezogen (Boldt, Gelhar 2008, S.48). Es konnte teilweise von einer Entvölkerung von ganzen Dörfern und Landstrichen gesprochen werden (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.48). Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die Zuwanderer aus dem Deutschen Reich, Österreich, den Niederlanden und Belgien (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.48).
Großunternehmer bauten ihre Imperien aus und weitere Bergbau- und Stahlbetriebe wurden gegründet. Das Abteufen von neuen Schächten, der Kauf von Dampfmaschinen und der Anschluss an das Eisenbahnnetz wurden teuer. Es war kaum möglich aus den selbst erwirtschafteten Gewinnen Investitionen zu tätigen, wie zu Beginn der Industrialisierung (vgl. Schlieper 1986, S.42f.). Die im Ruhrgebiet ansässigen Unternehmen wurden „zu einem wesentlichen Teil mit ausländischem Kapital, […] aus Belgien, England und Frankreich finanziert“ (Schlieper 1986, S.43). Es kam zu Gründungen von ersten Privatbanken und Aktiengesellschaften (vgl. Schlieper 1986, S.42f.). Durch die Finanzierung der Bergbauunternehmen und der Schwerindustrie von außen mussten die ausländischen Zulieferer- und Absatzmärkte an das internationale Verkehrsnetz gekoppelt werden. Die Eisenbahn wurde zum Motor der Industrialisierung. Je weiträumiger das Transportnetz der Eisenbahn war, desto größer war der Bedarf an Kohle, Stahl und Maschinen. Dieser Kreislauf förderte den Ausbau der Montanindustrie und die Dominanz des kapitalistischen Industriellen im Revier (vgl. Butzin, Pahs, Prey).
Nach dem „Take off“ des Ruhrgebiets kam es zu einer ersten Krise Mitte der 1860er Jahre. Gründe hierfür waren zum einen die Überproduktion sowie der Konkurrenzdruck und zum anderen der Rückzug des Staates als kontrollierende Instanz über die Löhne, Preise und den Absatz im Bergbau (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.42). Der Staat trat nun vielmehr als Auftraggeber und Investor in das wirtschaftliche Geschehen ein und verstärkte das Wachstum und gleichzeitig die Krise der Montanindustrie.
Durch den Sieg über Napoleon III. und dem Kaiserreich Frankreich im Deutsch – Französischen Krieg 1870/71 wurde die Industrie wieder angekurbelt. Frankreich musste Reparationszahlungen leisten. Preußen bekam das Gebiet Elsass – Lothringen, das reich an Erzvorkommen war, zugesprochen. Das entscheidende Ereignis für das Wachstum war jedoch die Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871. Es kam zu einer zweiten Gründungswelle von Großfirmen und Aktiengesellschaften. Während alte Industriestandorte im Süden des Ruhrgebietes aufgegeben wurden, erschlossen sich neue Räume weiter Richtung bis hin zur Lippe (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.46). „Bereits 1871 erreichte das Revier die Steinkohleförderquoten Frankreichs und die Roheisenquoten Belgiens“ und bald wurde auch das Mutterland Großbritannien überflügelt (Boldt, Gelhar 2008, S.45). Doch die Expansionsphase wurde durch den ersten weltweiten Börsencrash im Jahr 1873 gebremst. Die kleinen Bergwerke konnten der langanhaltenden Phase der Depression bis Mitte der 1890er Jahre nicht standhalten und verschwanden aus dem Revier. An deren Stelle traten Konzerne mit Großschachtanlagen und Malakoff – Türmen. Obwohl die Anzahl der Zechen sank, konnte die Fördermenge aufgrund der Rationalisierung und der Mechanisierung ausgeglichen werden (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.46f.). Der elektrische Strom wurde zur bahnbrechenden Innovation im Bergbau. Die Einführung von elektrischen Grubenbahnen und elektrische Pumpen beschleunigte den Transport und die Produktion (vgl. Budde).
Nach der Reichsgründung kam es zu einer dritten Einwanderungswelle. Ab 1880 kamen „vermehrt Arbeiter aus den deutschen Ostgebieten“ in die nördliche Emscherzone: Ost- und Westpreußen, Posen, Schlesien und Polen (Boldt, Gelhar 2008, S.48). „Die Migration führte dazu, dass sich innerhalb weniger Jahre vor allem in der Emscherzone […] völlig neue Siedlungsstrukturen“ und damit auch verbundene Sozialstrukturen sowie eine neue Arbeiterkultur bildeten (siehe Kapitel 3, ‚Exkurs: Siedlungsstrukturen‘) (Boldt, Gelhar 2008, S.48). Nur in der Arbeitswelt waren die Migranten integriert (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.48). Die Einwanderungswellen des 19. Jahrhunderts hatten „[s]oziale Diskriminierung, politische Verfolgung und Fremdenfeindlichkeit“ zur Folge. Ein markantes Beispiel hierfür waren die sogenannten „Polenzechen“: In der „Zeche Pluto“ in Herne waren „oft mehr als die Hälfte der Belegschaft polnisch“ (Boldt, Gelhar 2008, S.48). Um 1914 wurden im Ruhrgebiet bereits 3,5 Millionen Einwohner gezählt. Davon war eine halbe Million der Bevölkerung aus Polen stammend (vgl. Tenfelde 2010, S.23).
Zum Nachlesen:
Teil 1
Teil 2