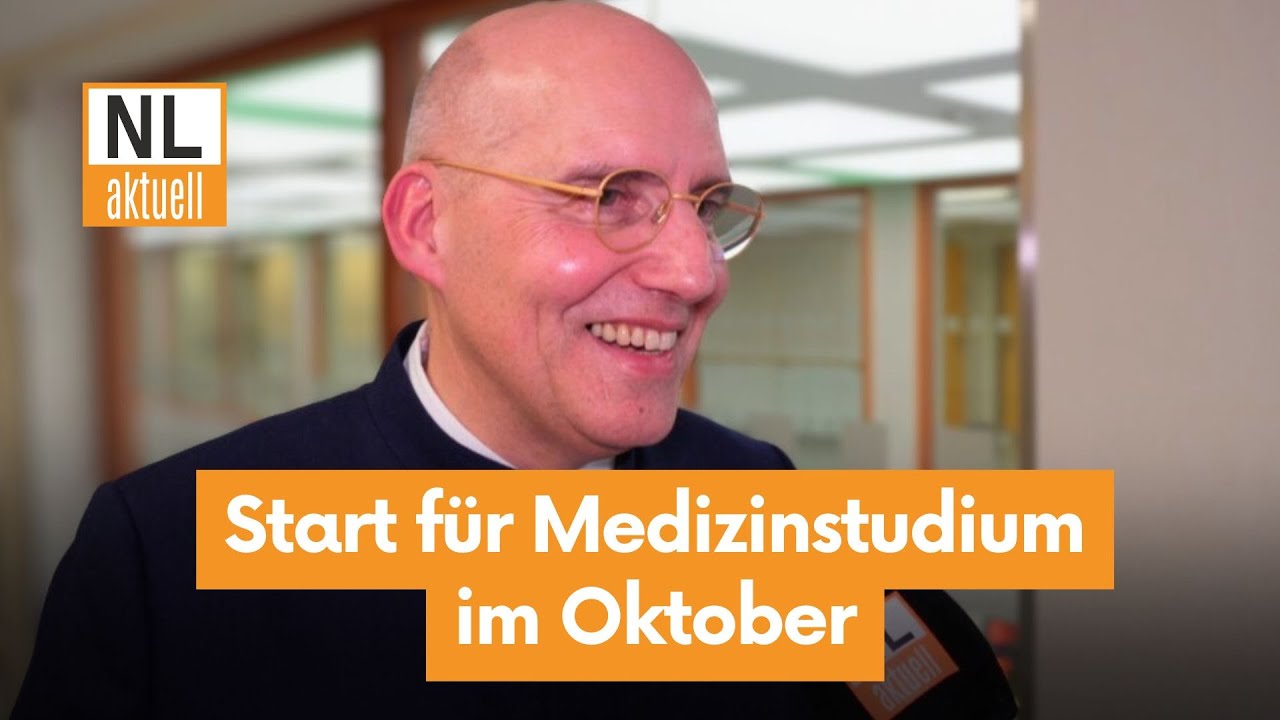Wir sitzen bei einem Kaffee an den Wasserspielen und Dipl. Gartenbauingenieur Jens Hofmann, Leiter des Ostdeutschen Rosengartens, erzählt von der Geschichte des Rosengartens.
Am 14. Juni 1913 eröffnete die Rosen- und Gartenbauausstellung auf der Wehrinsel und dem zusätzlichen Gelände, das zuerst gepachtet wurde. Bereits einige Jahre vorher wurden die beiden Wehrinseln bepflanzt und das gesamte Gelände in einen Volkspark nach englischen Stil umgewandelt. Die Wehrinselgaststätte wurde 1910 erbaut.
Die Rosen- und Gartenbauausstellung war ein großer Erfolg. Als Anerkennung verlieh der „Verein Deutscher Rosenfreunde e.V.“ dem Gelände mit den Rosengärten die Bezeichnung „Ostdeutscher Rosengarten“.
„Oft wird gefragt, warum es „Ostdeutscher Rosengarten“ heißt“, so Jens Hofmann. „In Zweibrücken wurde 1914 auf 6 Hektar der „Europagarten Zweibrücken“ eröffnet. Das ist der westlichste Rosengarten in Deutschland und in Forst (Lausitz) ist der östlichste Rosengarten Deutschlands.“
„Die größte Sammlung von Rosensorten der Welt ist aber im Europa-Rosarium im thüringischen Sangerhausen zu bewundern. 8.000 Rosensorten werden dort auf 16 Hektar gezeigt.“
„Die Forster Anlage hat ein anderes Konzept, die Rose war immer und ist ein Gestaltungselement im Ostdeutschen Rosengarten“, fügt er hinzu.
1938, zum 25-jährigen Bestehen, blühten zur „Deutschen Rosenschau“ 40.000 Rosen in 500 Sorten in 15 Abteilungen. Für jeden Forster blühte ein Rosenstock.
Ein Besucher aus Sachsen hat wohl das Gespräch gehört und fragt: „Wo finde ich „unsere“ schwarze Rose?“ Jens Hofmann zeigt ihm den Weg zur „Nigrette“, der östlichen „Schwarzen Rose“ und der „Norita“, der westlichen „Schwarzen Rose“.
In den letzten Wochen des 2. Weltkrieges standen sich die Rote Armee und die Wehrmacht an der Neiße gegenüber. Auch im Rosengarten verliefen Schützengräben und nach dem Ende der Kämpfe lagen 85% der Stadt Forst in Schutt und Asche. Die Forster, die in ihre Stadt zurückkehrten, hatten andere Sorgen als über Rosen nachzudenken. Gemüsegärten wurden auf dem Gelände angelegt.
Werner Gottschalk übernahm die Leitung des Rosengarten und lenkte die Geschicke von 1947 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1985. Es ging wieder aufwärts, bereits 1952 waren es fast wieder 12.000 Rosenstöcke und über 4.000 Dahlien. Die Gaststätte war zerstört und wurde 1953 neu gebaut.
Zum 40-jährigen Bestehen des Rosengartes im Jahr 1953 blühten wieder 20.000 Rosen.
Jens Hofmann erzählt von seiner Arbeit in Thüringen und seinem Wechsel nach Cottbus. Anfang der Neunziger las er ein Stellenangebot für den Ostdeutschen Rosengarten und bewarb sich.
Lange hörte er nichts; dann bekam er die Stelle als Leiter des Ostdeutschen Rosengartens.
„Ich wollte nie ein „Hofmannsche“ Lösung, ich wollte das ursprüngliche Konzept wiederherstellen“, sagt er. „Der Charme der Anlage ist die Tatsache, daß trotz der Schäden in den letzten Kriegswochen viel erhalten blieb. Erwähnenswert ist auch der altehrwürdige Baumbestand. Der Rosengarten ist eine denkmalgeschützte Anlage, ein Gartendenkmal. Gebäude und auch die Wegeführung sind geschützt.“
Neben den Rosenbeeten standen Douglasien, die in den Jahrzehnten zu großen Bäumen herangewachsen waren. Jens Hofmann wollte die Rosen wieder freistellen und ließ die Douglasien unter Protesten fällen. Er hatte Recht, die Rosenbeete kamen wieder zur vollen Geltung.
Bei einem Spaziergang durch den Rosengarten bleibt Jens Hofmann immer wieder stehen und zeigt auf eine Rose, die einen betörenden Duft verströmt, die ihre großen, kräftigen Blüten präsentiert oder bei der das Laub besonders dicht ist. Man merkt ihm an, dass seine Tätigkeit für ihn mehr als nur ein Beruf ist.
Wir gehen zum Neuheitenteil, der ihm besonders am Herzen liegt. „Wir kooperieren mit dem Europagarten in Zweibrücken und dem Europa-Rosarium in Sangerhausen. Nicht jede Rose, die dort wächst, gedeiht auch in unserem kontinentalen Klima mit den leichten Böden“, sagt Jens Hofmann. Im Neuheitenteil können Rosenliebhaber der Region zu sehen, ob eine Rose der Beschreibung in einem Katalog entspricht. Drei Jahre bleiben die fast 100 Sorten hier. Jeder kann die Rose, die ihn interessiert, über den langen Zeitraum beobachten. Bleibt sie gesund? Überlebt sie einen kalten Winter? Ist sie für unsere Region geeignet?“
Nur geeignete und gesunde Sorten werden nach der Testzeit umgepflanzt.
Der Neuheitenteil ist gut besucht und mehrfach wird Jens Hofmann angesprochen. Besucher berichten von ihren Rosen oder fragen, ob diese oder jene Sorte für die Region geeignet ist.
Die Auszeichnung zum „Schönsten Park Deutschlands“ am 13.9.2009 (Siehe Artikel vom 13. September) ist für ihn Verpflichtung, das Niveau der Anlage zu halten und Ansporn, den Ostdeutschen Rosengarten weiter zu entwickeln.
Jens Hofmann wünscht sich, dass die Forster die Anlage als „ihren“ Rosengarten sehen und jeder Forster das Gefühl hat, eine der vielen Rosen blühe für ihn.
Noch sei einiges zu tun, so Jens Hofman. Das Ziel des sehr aktiven „Förderverein Ostdeutscher Rosengarten e.V.“ mit dem Vorsitzenden Hans-Rainer Engwicht ist der Erhalt des Gartens als Gartenkunstwerk. Im Vordergrund steht die Rose.
Vieles konnte bisher mit Hilfe des Fördervereins umgesetzt werden, der immer dann einspringt, wenn es mit der Zielsetzung vereinbar ist und die Stadt die notwendigen Mittel nicht zur Verfügung stellen kann.
Jens Hofmann hat freundlichweise eine Reihe von historischen Aufnahmen des Rosengartens zur Verfügung gestellt. Die Fotos werden in den nächsten Tagen in dem Bereich Historische Bildergalerie zu sehen sein.
Foto 2: Hauptachse
Foto 3: Die „Schwarze Rose“ – Norita
Forster Rosengartenfesttage 2026: Tim Bendzko als Hauptact angekündigt
Die Rosengartenfesttage 2026 versprechen Mitte Juni wieder drei Tage Open-Air-Musik im Ostdeutschen Rosengarten Forst. Vom 12. bis 14. Juni sorgen...