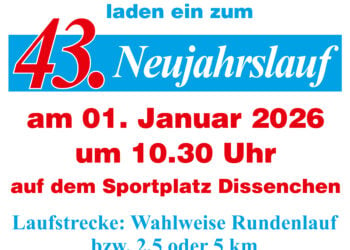Die Erntezeit für den Spreewälder Meerrettich ist gestartet. In Klein Klessow wurde heute die handarbeitsintensive Aufarbeitung der Wurzeln gezeigt und über den Anbau informiert, der in der gesamten Spreewaldregion rund 10 Hektar Fläche und etwa 120 Tonnen Erntemenge umfasst. Im Mittelpunkt standen zudem der Sortenerhalt der „Alten Spreewälder Landsorte“ und die regionalen Verarbeitungsschritte.
Einblick in Anbau und Ernte des Spreewälder Meerrettichs
Meerrettich wird im Spreewald seit Generationen angebaut und verarbeitet. Seit 1999 trägt er das blaugelbe EU-Siegel der „Geschützten Geographischen Angabe“ (g.g.A.), das ihn als regionale Spezialität ausweist. Der Spreewaldverein e.V. als Träger der Schutzgemeinschaft „Spreewälder Meerrettich“ hatte Anbauer, Verarbeiter und Medienvertreterinnen und -vertreter zum Pressegespräch an den Meerrettich-Schlag des Gemüsebaubetriebs von Dirk Richter in Klein Klessow eingeladen.
Dort konnten die handarbeitsintensive Ernte und Aufarbeitung der Wurzel verfolgt werden. Landwirt Dirk Richter bewirtschaftet in diesem Jahr rund 1,5 Hektar Meerrettich. Aufgrund ausreichender Niederschläge zeigte er sich zufrieden mit Bestand und Ernte. Ein Großteil seiner Fläche ist mit der „Alten Spreewälder Landsorte“ bepflanzt, deren Erhalt durch einen Sortenerhaltungsanbau gesichert wird. Dieser wird mit Unterstützung des UNESCO Biosphärenreservats Spreewald umgesetzt und trägt zum Fortbestand der traditionellen Herkunft bei.

Anbaufläche, Rarität und regionale Bedeutung
Wie der Spreewaldverein weiter mitteilte, werden in der gesamten Spreewaldregion etwa 10 Hektar Meerrettich von vier Gemüsebaubetrieben angebaut. Das entspricht einer Erntemenge von rund 120 Tonnen. Laut Geschäftsführerin Melanie Kossatz ist die Anbaufläche seit vielen Jahren stabil, wenngleich die Betriebsgrößen schwanken. Aufgrund der vergleichsweise geringen Fläche gilt Spreewälder Meerrettich weiterhin als besondere Rarität.
Verarbeitung in regionalen Betrieben
Die frisch sortierten Meerrettichwurzeln gelangen anschließend zu zwei Verarbeitungsbetrieben im Spreewald. Markus Belaschk von der Firma SpreewaldRabe erläuterte den ersten Verarbeitungsschritt: Nach der Ernte wird der Meerrettich zwei bis drei Wochen eingefroren, damit sich das Enzymleben in den Wurzeln beruhigt. Im Anschluss lagert er bei -2 bis -4 Grad Celsius, bevor er weiterverarbeitet wird. Beide Verarbeitungsbetriebe bieten jeweils rund zehn Sorten im Glas an. Diese reichen von klassisch puren Varianten bis zu Rezepturen mit Sahne, Apfel, Preiselbeere, Ingwer oder Senf. In der Spreewälder Küche verfeinert Meerrettich traditionell Fleisch- und Fischgerichte sowie regionale Spezialitäten wie die geschützte Spreewälder Gurkensülze.
EU-Siegel und Dachmarke „Spreewald“
Das EU-Siegel „Geschützte Geographische Angabe“ garantiert den regionalen Ursprung des Produkts. Neben dem Meerrettich tragen auch Spreewälder Gurken, Spreewälder Gurkensülze, der Peitzer Karpfen und Beelitzer Spargel dieses Gütezeichen. Ergänzend dient die Dachmarke „Spreewald“ des Spreewaldvereins als freiwilliges Regionalzeichen für geprüfte Qualität und Herkunft. Beide Kennzeichnungen stärken die regionale Wertschöpfung und fördern Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Mitgliedsbetriebe der Schutzgemeinschaft
Erzeugerbetriebe
- Gemüsebetrieb Dirk Richter, Klein Klessow
- Gemüsebaubetrieb „Spreewald“, Klein Radden
- Gurkenhof Frehn, Steinreich
- Agrargenossenschaft Unterspreewald eG, Dürrenhofe
Verarbeitungsbetriebe
- RABE Spreewälder Konserven GmbH, Boblitz
- Meerrettichreiberei Koal, Lehde
Heute in der Lausitz – Unser täglicher Newsüberblick
Mehr Infos und News aus der Lausitzer und Südbrandenburger Region sowie Videos und Social-Media-Content von heute findet ihr in unserer Tagesübersicht –>>
Hier zur Übersicht
Red. / Presseinformation
Bild: Spreewaldverein e.V. / Peter Becker