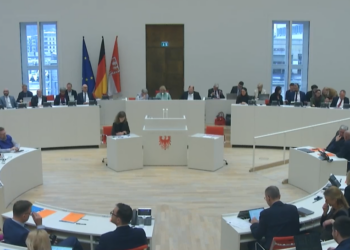Als Ergebnis der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur am 8. August 2012 im Landtag Brandenburg geht der Lausitzer Abgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann zwar davon aus, dass die Ministerin kaum von ihrer Position abweichen und das „Eindampfen“ der beiden bestehenden Hochschuleinrichtungen BTU und Hochschule Lausitz und die Gründung einer „Lausitz-Universität“ im Süden Brandenburgs vorantreiben wird. Er meint aber auch, dass nach allem, was bisher gelaufen ist, dieses Herangehen kaum etwas mit der Weiterentwicklung der brandenburgischen Hochschullandschaft zu tun hätte.
Zur aktuellen, sich zuspitzenden, Debatte um das Hochschulsystem des Landes Brandenburg insgesamt, besonders aber um die Zukunft der Hochschule Lausitz Senftenberg und die Brandenburgische Technische Universität Cottbus erklärt der Lausitzer Landtagsabgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann:
„Die Äußerungen des Staatsekretärs Martin Gorholt, der die zuständige Ministerin während der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur am 8. August 2012 im Landtag vertrat, waren deutlich: Über alles könne diskutiert werden, nur das Ergebnis würde feststehen, nämlich nur noch eine Hochschuleinrichtung im Süden Brandenburgs. Einmal davon abgesehen, dass die Abgeordneten des Landtages darüber entscheiden werden, so wird damit drastisch deutlich, dass auch gute Ideen auf der Strecke bleiben, wenn sie mit dem Etikett ‚alternativlos’ versehen sind und als Ansage daherkommen. Aus meiner Sicht ist jetzt wohl endgültig ein Punkt erreicht, an dem kaum noch eine einvernehmliche Lösung möglich ist. Deshalb sage auch ich, die Forderungen der Volksinitiative, beide Hochschuleinrichtungen im Süden des Landes Brandenburg zu erhalten und auch die Juristische Fakultät der Universität Potsdam nicht zu schließen, sind richtig. Die entgegengesetzten Vorschläge der Ministerin haben nach meiner Auffassung wenig mit den eigentlichen Fragen der Hochschulpolitik des Landes zu tun. Der bisher vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz findet nicht meine Zustimmung. Wenn nichts Grundsätzliches geändert wird, werde ich im Landtag dagegen stimmen.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Hochschuldebatte in den letzten Monaten gelaufen ist, kann allerdings die Ablehnung dieser Vorschläge nur ein erster Schritt sein. Denn durch die Zuspitzung reduzierte sich der Streit auf ein Dafür oder ein Dagegen. Diese Situation kann aber schnell zu Scheinlösungen führen. Es könnte die Zeit der faulen Kompromisse werden. Damit meine ich, dass es dann eben wieder nicht um die Überwindung der chronischen Unterfinanzierung der Hochschulen geht oder um eine gerechtere Mittelverteilung, die Hochschulen an der Peripherie des Landes nicht mehr benachteiligt, oder um die Sicherung der Studierendenzahlen, sondern dass es nur noch um ‚Gesichtswahrung’ durch Zugeständnisse auf beiden Seiten geht. Rechthaberisches Aufbäumen oder Zugeständnisse auf Nebenschauplätzen bringen die Sache selber nicht voran.
Also, schön logische Power-Point-Präsentationen und martialische Protestplakate sollten in die Besenkammer. Ihr Aufeinandertreffen produziert nichts Konstruktives mehr. Herausgeholt werden müssten die Listen der wirklichen Probleme, so wie sie in den Abschlussberichten der Lausitzkommission und der Hochschulstrukturkommission wie auch in den Stellungnahmen verschiedener Hochschulgremien, der Gewerkschaften, der
Landesrektorenkonferenz, politischer Jugendverbände, der Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik und schließlich auch der Volksinitiative ‚Hochschulen erhalten’ benannt wurden. Aber auch einige Vorschläge der Ministerin sollten neu und – obwohl es einigen vielleicht auch schwer fällt – unvoreingenommen gelesen werden.
Denn einige der wirklich offenen Fragen sind doch die folgenden:
– Wie kann gewährleistet werden, dass die unterschiedlichen Profile und Aufgaben von Universitäten und Fachhochschulen erhalten bleiben?
– Wie steht es mit der ursprünglichen Festlegung, dass Brandenburg, auch in Zahlen ausgedrückt, vor allem Studierende an Fachhochschulen haben wollte, und der Tatsche, dass es ganz anders gelaufen ist?
– Was kann getan werden, damit die Universitäten des Landes zur Metropolenfunktion ihrer Standorte beitragen, also Ankerfunktion und Strahlkraft nach außen gewinnen?
– Sollte man sich damit abfinden, dass die finanziellen Mittel auch zukünftig nicht reichen und deshalb eine Vollstruktur an jeder einzelnen Universität/Hochschule im Land Brandenburg nicht möglich sein wird, dafür besser ein sich ergänzendes System mit Bezug auf das Land insgesamt entwickelt werden müsste?
– In welchem Verhältnis sollten Wettbewerb und Kooperation benachbarter Hochschuleinrichtungen stehen?
– Wie kann mit dem Spannungsfeld konstruktiv umgegangen werden, einerseits Lehre und Forschung nur noch nach internationalen Maßstäben ausrichten zu müssen und andererseits dennoch wirtschaftlich, sozial und kulturell regional verankert zu bleiben?
– Was war eigentlich der Gründungsauftrag der Viadrina?
– Was muss getan werden, damit Hochschulabsolventen eine Perspektive im Land Brandenburg haben?
– Wie steht es mit der Bildungsgerechtigkeit?
Das sind nur einige Fragen, die strategisch beantwortet werden sollten bzw. auch erst einmal als offene Fragen zugelassen werden müssten.
Die Klärung wird als Prozess zu gestalten sein. Das ist die eigentliche Herausforderung. Zur Lösung wird dann mit Sicherheit wieder stärker auch die Fachebene im Hochschulministerium gefragt sein müssen. Ich gehe davon aus, dass die beiden Seiten, die sich scheinbar unversöhnlich gegenüber stehen, eigentlich nur das Beste für die Hochschulen und Universitäten des Landes wollen. Es wäre mutig, die Reset-Taste zu drücken und mit der eigentlichen Arbeit zu beginnen. Einladend, offen und dennoch ergebnisorientiert.“
Quelle: Büro Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann, MdL, Die LINKE, Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Landratswahlen am Sonntag im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Am kommenden Sonntag wählen die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Oberspreewald-Lausitz eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat. Drei Bewerbende...