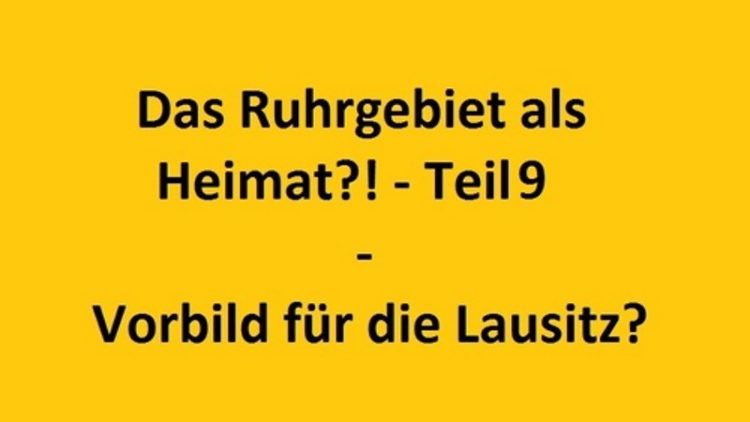Die ersten Veränderungen im Ruhrgebiet zeigten sich im letzten Teil nun geht es um die Bodensperre und der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft sowie dem demographischen Wandel.
1.8 Bodensperre
Problematisch war allerdings die Wirtschaftsförderung. Das Ruhrgebiet sollte mit Hilfe des Entwicklungsprogramm Ruhr (1968 – 1973) und des Nordrhein – Westfalen – Programm 1975 den Wandel von Industriegesellschaft zu Dienstleistungsgesellschaft vollziehen. Das montanindustrielle Cluster war jedoch stark in der wirtschaftlichen Struktur verankert. Durch die Dominanz der Stahl- und Bergbaukonzerne mit ihrem immensen Flächenbesitz im Revier wurde die Ansiedlung von neuen Unternehmen bis Ende der 60er verhindert. Die Bodensperre blockierte die Niederlassung von Ford, VW und Schering und grenzte mögliche neue Basistechnologien für das Ruhrgebiet aus. Standortwechsel waren die Folge (vgl. Butzin, Pahs, Prey). Auch „die im Ruhrgebiet ansässigen und dominierenden Branchen sahen sich durch die regionale Förderpolitik veranlasst, neue Betrieben und Kapazitäten außerhalb der Region zu schaffen“ (Schlieper 1986, S.186). Die Entwicklung und der strukturelle Wandel fanden außerhalb des Ruhrgebietes statt. Die ausgeprägte Montanindustrie stand nicht nur Neuansiedlungen im Weg, sie blockierte auch die innovative Kraft der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die zahlreichen kleineren Industrie- und Dienstleistungsbetriebe fungierten über lange Zeit als Zulieferer der Montanindustrie. Aufgrund der stabilen Bindung zwischen Zulieferer und Abnehmern entstand eine hohe Abhängigkeit zu den Berg- und Stahlbetrieben. Obwohl sich Anfang der 70er Jahre tatsächlich Auflockerungen in der Wirtschaftsstruktur zeigten, blieb die Dominanz der Berg- und Stahlindustrie erhalten (vgl. Schlieper 1986, S.189ff.).
Erst mit dem Grundstückfonds Ruhr im Rahmen des Aktionsprogramms Ruhr 1980 wurde die Bodensperre aufgehoben. Brachliegende Industrie- und Gewerbeflächen wurden von der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) des Landes Nordrhein – Westfalen saniert und für die neue Nutzung erschlossen. Mit Beginn des Flächensanierungswahns Ende der 60er waren die ökologischen und im Boden befindlichen Altlasten noch nicht behoben. Aufgrund der unbekannten Risiken bei Altlastenverdacht, wie dem Austreten chemischer Substanzen oder dem Fund von Sprengkörpern beim Bau, wurde der Kauf von Brachflächen von möglichen Investoren oft abgelehnt. Durch den Grundstücksfonds Ruhr konnten unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit die weichen Standortfaktoren für die Ansiedlung neuer Branchen verbessert werden. Unter dem Gedanken ‚Brachflächen als Jahrhundertchance‘ der Stadterneuerung zu sehen, wurde das Image des Ruhrgebiets langsam positiv besetzt (vgl. Butzin, Pahs, Prey).
1.9. Dienstleistungsgesellschaft
„Indikatoren des Strukturwandels hin zur Dienstleistungsgesellschaft [waren] ein der sinkender Anteil der Beschäftigten im sekundären Sektor und Veränderungen im Anteil der industriellen Produktion am Bruttoinlandsprodukt“ (Boldt, Gelhar 2008, S.57). „Bundesweit verringerte sich zwischen 1962 und 1976 die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie um rund 7,8%; im Ruhrgebiet gingen im gleichen Zeitraum 30% der industriellen Arbeitsplätze verloren“ (Schlieper 1986, S.189). An der Stilllegung von Zechen und Kokereien waren nicht nur Arbeitsplätze im Bergbau gebunden, sondern auch Stellen im Dienstleistungsbereich. Es wurde versucht den Wegfall der Arbeitsplätze im sekundären Sektor mit dem Ausbau des tertiären Sektors auszugleichen (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.82). Dies zeigt auch die Entwicklung der Wirtschaftssektoren in Nordrhein – Westfalen (NRW) und im Regionalverband Ruhr (RVR) im Vergleich der Jahre 1980 und 2005 (siehe Abbildung 3). 1980 nahm der sekundäre Sektor immer noch circa die Hälfte der Gesamtwirtschaft in NRW und im RVR ein. Das Ruhrgebiet entwickelte sich in den folgenden Jahren zur Dienstleistungsgesellschaft. Im Jahr 2005 war der sekundäre Sektor nur circa ein Viertel (NRW 30%; RVR 28%) an dem gesamtwirtschaftlichen Stand beteiligt. Die Städte des Ruhrgebiets von heute sind Dienstleistungsstädte wie Dortmund, Essen und Oberhausen. Diese Entwicklung steckt bisher noch in den Anfängen (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.82ff.).
1.10. Demographischer Wandel
Trotz des Wachstums im Dienstleistungsbereich konnten die reduzierten Arbeitsplätze im sekundären Sektor nicht in vollem Umfang ausgeglichen werden (vgl. Schlieper 1986, S.189ff.). Einhergehend mit der Deindustrialisierung ist ein demographischer Wandel im Revier. Die zukunftslose beziehungsweise zukunftsunsichere Lage hat eine Abwanderung zur Folge. Besonders die Abwanderung jüngerer Bevölkerungsgruppen ist zu verzeichnen. Dies verschärfte den Prozess der Alterung der bleibenden Bevölkerung (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.92). Aufgrund der Emigration wurde der Rückbau von Wohnsiedlungen notwendig. „Überalterung und die schwindende Mobilität älterer Menschen machen angepasste Strategien in Zukunft wichtiger denn je“ (Boldt, Gelhar 2008, S.92). Mit neuen, innovativen Leitbildern der Raumplanung und der Gestaltung von Immobilien wurde versucht die Region attraktiv zu machen. Grünanlagen und alternative Freizeitmöglichkeiten sollen leerstehende Wohnsiedlungen aufwerten. Aus dem Rückgang der Bevölkerung folgt ein Werteverfall der Immobilien. Die Wohnungen können daher zu günstigen Mietpreisen angeboten werden. Zwar wird es für die Bürger möglich sich eine gute und billige Wohnung zu leisten, doch aufgrund einer möglichen Sanierung oder einem Rückbau rechnen die Bewohner mit steigenden Lebenshaltungskosten. Das hätte einen Verdrängungsprozess zur Folge und würde die Emigration der ohnehin schon leerstehenden Siedlungskomplexe nicht lindern. Im Gegenteil die Verdrängung würde nur eine räumliche Verlagerung der sozialen Probleme mit sich bringen. Dieses Szenario würde den demographischen Wandel verstärken (vgl. Boldt, Gelhar 2008, S.92ff.). Wie aus der Abbildung 4 hervorgeht, wird bis zum Jahr 2020 ein Bevölkerungsrückgang in vielen Bezirken erwartet. Besonders betroffen werden die Bezirke südlich der Rhein-, Ruhr-, Hellweg- und Emscherzone sein (Duisburg, Oberhausen, Essen, Mühlheim, Bochum, Herne, Gelsenkirchen).
Abbildung 3: Entwicklung der Wirtschaftssektoren im Ruhrgebiet und in NRW (1980/2005) (Boldt, Gelhar 2008, S.83)
Das Ruhrgebiet als Heimat?! – Teil 9 – Vorbild für die Lausitz?
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT