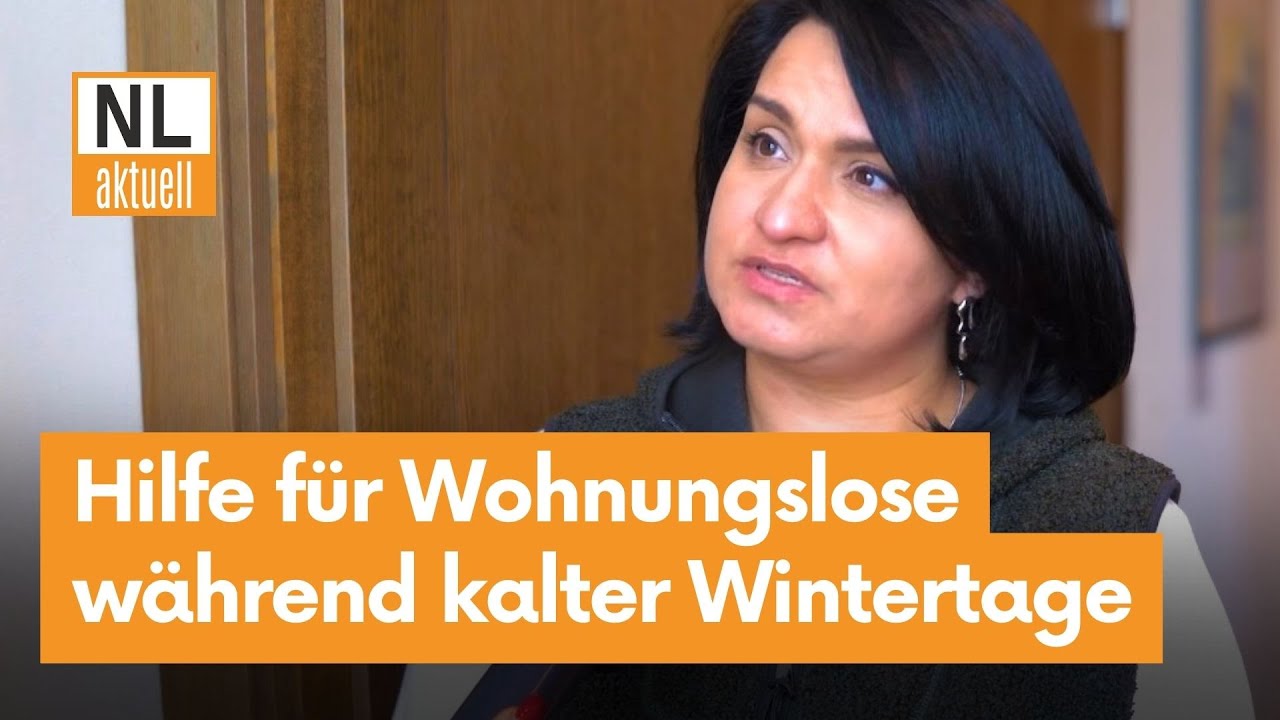Ein verbesserter Landschaftswasserhaushalt und Lebensraum für gefährdete Arten, gerettete Calluna-Heiden und erworbene 5.000 ha Naturschutzfläche – das zählt zur erfolgreichen Bilanz des Naturschutzgroßprojektes Uckermärkische Seen. Nach 15 Jahren Laufzeit endete das Vorhaben im Februar 2011. „Mit 20,5 Millionen Euro beschließen wir nicht nur das bislang größte, sondern sicher auch eines der erfolgreichsten Naturschutzgroßprojekte der Bundesrepublik“, sagte Umweltstaatssekretär Daniel Rühmkorf heute in Templin.“
Der Vorhabensträger, der Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlandschaft, habe nicht nur einen äußerst langen Atem bewiesen und Meilensteine für den Brandenburgischen Naturschutz gesetzt, betonte Rühmkorf. „In jahrelanger, sehr guter Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsbetrieben der Region, der Landesforstverwaltung und den meisten Kommunen gelang es ihm immer wieder, tragfähige Kompromisse zwischen Schutz und Nutzung zu erreichen. So nahm die Akzeptanz für das Großprojekt stetig zu.“ Projektpartner des Fördervereins waren neben dem Naturpark Uckermärkische Seen der WWF Deutschland, der NaturschutzFonds Brandenburg und die Landkreise Uckermark und Oberhavel.
Eine Vorreiterrolle für Brandenburg spielt das Naturschutzgroßprojekt Uckermärkische Seen insbesondere beim Moorschutz. Nirgendwo sonst in Brandenburg wurden Maßnahmen zu Wasserrückhaltung und Moorschutz so konzentriert umgesetzt wie beim Großprojekt in der Uckermark: An 156 Mooren und Gewässern mit rund 700 ha Fläche stieg der Wasserstand. Das nutzt Moorfrosch und Rotbauchunke, Seeadler und Fischotter sowie vielen anderen gefährdeten Arten. Die Projektverantwortlichen sanierten ganz verschiedene Typen von Mooren, allen voran Kalkflachmoore, deren Verbreitung im Projektgebiet landesweit Spitze ist. Naturnahe und zugleich kostengünstige Bauweisen kamen zur Erprobung und Anwendung.
Durch den Flächenerwerb bzw. die zweckgebundene Übertragung von Flächen an den Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlandschaft oder Projektpartner wie den WWF bleibt der Projekterfolg gesichert. So werden zum Beispiel die Waldflächen auch in Zukunft entsprechend der Naturschutzziele im Pflege- und Entwicklungsplan des Projektes behandelt. Die Bandbreite reicht hier von absoluten Ruhezonen in den Naturentwicklungsgebieten auf der einen Seite bis zu waldbaulichen Aktivitäten, um die Dominanz der Nadelhölzer weiter zurückzudrängen, auf der anderen. Auch das ist ein, wie viele wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, Beitrag zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes und zur Entwicklung der Moore und Seen. Auch für das Offenhalten von 700 ha Heide- und Binnendünenflächen wurde durch Flächenerwerb oder Anpachtung Sorge getragen.
Quelle: Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Foto © Marek Szczepanek (wikipedia.org)
Geflügelpest: Schutzmaßnahmen in Dahme-Spreewald werden aufgehoben
Im Landkreis Dahme-Spreewald wird die Stallpflicht für Geflügel aufgehoben. Wie der Landkreis mitteilte, gilt die Maßnahme ab morgen, auch in...