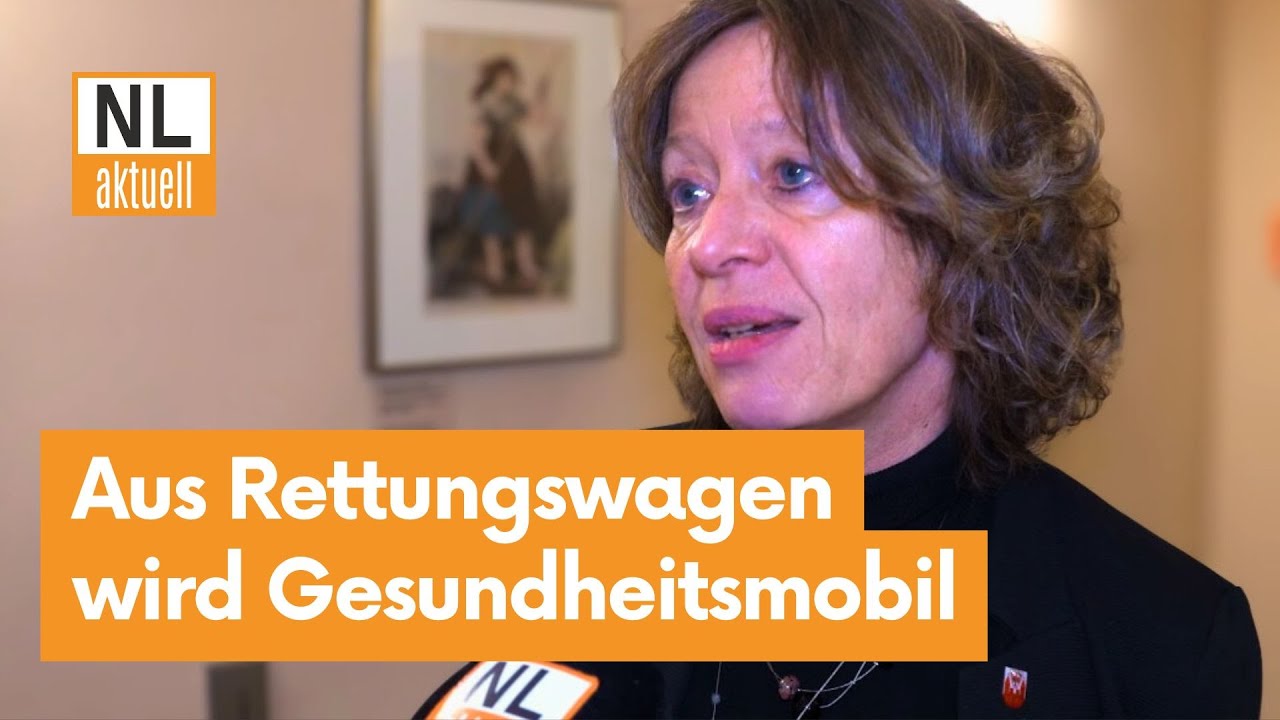Anfang September wurde der Abschlussbericht zum Pilotvorhaben Düseninjektion Skadodamm zur in-situ Grundwassersanierung in der LMBV vorgestellt. „Eisen und Schwefel wurden mit Hilfe hungriger Bakterien direkt schon in der Kippe zu 90 bzw. 40 Prozent aus dem sauren und mineralhaltigen Grundwasserzustrom abgereichert und das gestellte Ziel erreicht werden“ konnte der Leiter der LMBV-Geotechnik Eckhard Scholz konstatieren. Im Rahmen dieses erfolgreichen Pilot- und Demonstrationsvorhaben der LMBV wurde von den Forschern in der Lausitz eine Anlage zur mikrobiellen in-situ Sanierung von bergbaulich beeinträchtigtem Wasser geplant, gebaut und über einen Zeitraum von zwei Jahren durch das Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V (FIB) in Zusammenarbeit mit der BTU Cottbus betrieben. Aufbauend auf den Ergebnissen des Pilotvorhabens wurde von den Forschern im Rahmen einer Vorkonzeption für einen weiteren – noch beispielhaften – Lausitzer Sanierungsstandort eine Grundwasserbehandlungsanlage in größerem Maßstab vorgestellt, deren künftige Umsetzbarkeit die LMBV mit den Behörden weiter erörtern wird.
Ziel des ausgewerteten Vorhabens war die Fällung von Eisensulfiden durch mikrobielle Sulfat- und Eisenreduktion in einem Kippengrundwasser am Standort Skadodamm im Lausitzer Seenland. Das versauernd wirkende Eisen und Sulfat im Grundwasserstrom zum Bergbaufolgesee Sedlitz sollten im Erprobungszeit zwischen 2007 und 2010 durch sulfatreduzierende Bakterien reduziert und als Eisensulfid gefällt werden. Um die im Grundwasserleiter vorhandenen Mikroorganismen zu aktivieren, ist Glycerin als mikrobiell verwertbare Kohlenstoffquelle in den Untergrund infiltriert worden. Das lokal gehobene Grundwasser wurde mit Glycerin und Nährstoffen angereichert und über Infiltrationslanzen in den Kippengrundwasserleiter zurück infiltriert. Die Grundwasserbehandlung erfolgte quer zur Grundwasserströmung. Der Sanierungsbetrieb, d. h. die Infiltrationsraten und die Dosierung, sind anhand der im Abstrom gemessenen Wasserqualität gesteuert worden.
Das Pilotvorhaben lief in drei Phasen ab. Nach der Einfahrphase wurde periodisch Sanierungsreaktion initiiert. In der Optimierungsphase stabilisierte sich die Eisen- bzw. Sulfatreduktion und weitete sich der unterirdische Reaktionsraum aus. In der Regelbetriebsphase erfolgte ein erfolgreiches Wiederanfahren des Untergrundreaktors nach Betriebspause und Demonstration des sicheren Sanierungsbetriebs. Bereits zum Ende der Optimierungsphase sowie während des gesamten Regelbetriebs wurden die Zielgrößen für die Parameter Eisen(II), Sulfat und Neutralisationspotential im Abstrom der Pilotanlage zuverlässig erreicht:
Die Abreicherung der Eisen(II)-Konzentrationen im behandelten Grundwasser lag während des Regelbetriebs bei 90 Prozent. Die Absenkung der Sulfatkonzentrationen im Abstrom zum Sedlitzer See erreichte in der Grundwasserbehandlung während des Regelbetriebs rund 40 Prozent. Auch Anhebung des Neutralisationspotentials im Regelbetrieb von Ausgangswerten um -10 bis -12 mmol/l auf Werte um 0 mmol/l gelang wie vorhergesagt. Die ursprünglich potentiell starke Säurewirkung des Grundwassers konnte vollständig abgebaut werden. Während der Betriebspause von 110 Tagen zeigte sich ein deutliches Nachwirken der Grundwasserbehandlung innerhalb des geschaffenen Reaktionsraumes. Die Sulfatkonzentrationen blieben 80 bis 90 Tage im Zielwertbereich. Ein Anstieg der Eisenkonzentrationen erfolgte erst nach 90 bis 130 Tagen. Bei der erneuten Inbetriebnahme setzte die Sanierungsreaktion wesentlich schneller ein als in der Einfahrphase.
Deutlich wurde, dass die für die in-situ-Sulfatreduktion im Kippengrundwasserleiter erstmals eingesetzten DSI-Lanzen problemlos funktionierten. Sie sind prädestiniert für eine im größeren Maßstab sichere und ökonomische Verteilung von Glycerin bzw. Nährstoffen im Grundwasser. Die Behandlungsbreite des Verfahrens lässt sich durch eine Erhöhung der Lanzenzahl einfach variieren.
Mit diesem Pilot- und Demovorhaben konnten durch Sanierer und Forscher erfolgreich nachgewiesen werden, dass durch Stimulation von in der Kippe vorhandenen sulfatreduzierenden Bakterien eine deutliche Verbesserung der Wasserqualität mit relativ einfachen und preiswerten Mitteln möglich ist. Damit bietet sich das Verfahren für die Gütesteuerung in der Bergbausanierung als eine weitere Möglichkeit – neben dem Einsatz von Bekalkungsschiffen oder Getauchten Schwimmleitungen mit Düsen – zur Behandlung sauerer Bergbaufolgeseen an.
Auftragnehmerin für dieses Forschungs- und Praxisvorhaben war das Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V. unter Federführung von Dr.-Ing. Martin Gast in Kooperation mit PD Dr. rer. nat. habil Ralph Schöpke von der BTU Cottbus unter Mitarbeit von Dipl.-Ing. Manja Walko vom FIB e.V. Auf Seiten der LMBV haben Dr.-Ing. Friedrich-Carl Benthaus und Dr. Oliver Totsche das Vorhaben intensiv fachlich begleitet.
Quelle & Bild: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH