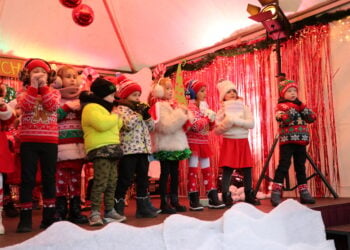Ein Gutachten das von der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) in Auftrag gegeben wurde und herausfinden sollte, wie hoch der Sulfatanteil in der Spree durch Berbausanierungsprojekte in der Lausitz ist, förderte zutage, das neben dem Anteil der LMBV (30% 2014 mit ca. 67.100 Tonnen pro Jahr) aktive Braunkohletagebaue und die daran angeschlossenen Kraftwerke in Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg für einen Großteil der hohen Sulfatwerte in der Spree sorgen. Insgesamt ist Vattenfall für 54% (121.900 Tonnen pro Jahr) der Sulfatbelastungen verantwortlich. Damit ergibt sich ein Gesamtanteil von 84% durch bergbaubedingte Eingriffe an der steigenden Sulfatbelastung der Spree.
Gleichzeitig zeigt die Studie auf, dass die Verringerung der Belastung durch die Talsperre Spremberg nur etwa 7% ausmacht und durch Versickerung, Dammumspülung und infolge der Trichterabsenkung des Tagebaus Welzow-Süd zustande kommt. Bereinigt man die Werte um die natürlichen Annahmen, trägt der aktive Tagebau derzeit zu 64% und der Sanierungsbergbau zu 36% am Sulfateintrag in die Spree bei. In der Prognose verändern sich die Zahlen nur geringfügig, die Studie geht von einer 60/40 Teilung aus.
In der Studie heißt es „Der Braunkohlenbergbau in der Lausitz trägt aus Grubenwasserreinigungsanlagen, aus der Kühlturmabflut von Braunkohlenkraftwerken, aus Bergbaufolgeseen und durch diffuse Grundwasserzutritte in Gebieten des Grundwasserwiederanstiegs Sulfat in die Spree ein. Die durchflussgemittelte Hintergrundkonzentration für Sulfat in der Spree beträgt 70 mg/L. Im Jahr 2014 wurden, befördert durch anhaltend niedrige Abflüsse, in der Spree in Spremberg-Wilhelmsthal erstmals über 600 mg/L, am Ausgang des Spreewaldes über 450 mg/L und in Beeskow über 300 mg/L Sulfat gemessen. Damit wird die Trinkwassergewinnung des Wasserwerkes Briesen aus Uferfiltrat gefährdet.“ Das Wasserwerk versorgt etwa 65.000 Abnehmer mit Trinkwasser. Ab einer Belastung von 500mg/L können bei gesunden Menschen Durchfall und Erbrechen auftreten. Die Deutsche Trinkwasserverordnung sieht einen Grenzwert von 250 mg/L Trinkwasser vor. Weitere Probleme treten bei hoher Konzentration in der Infrastruktur auf. Sulfate erhöhen die Korrosion von Rohrleitungen und Beton. Im Briesener Wasserwerk wird unterdessen ein erhöhter Anteil unbelastetes Grundwasser dazugemischt, was laut Potsdamer Neuesten Nachrichten vom 25.07. jedoch nicht beliebig ausbaubar ist.
Zu den konkreten Quellen des Sulfateintrags heißt es in der Studie: „Der Braunkohlenbergbau in der Lausitz trägt beträchtliche Sulfatmengen in die Spree ein. Der Sulfateintrag erfolgt durch Einleitung aus Grubenwasserbehandlungsanlagen des Braunkohlenbergbaus, durch Einleitung der Kühlturmabflut aus Braunkohlenkraftwerken, durch Ausleitung aus Bergbaufolgeseen, durch Grundwasserzutritt, aus bergbaulich belasteten Fließgewässern und aus diversen Dränagen in Ortslagen, die zur Abwehr der Folgen des Grundwasserwiederanstiegs errichtet wurden.“
Die Prognose für die künftige Belastung geht von keiner wesentlichen Veränderung der Belastung bis 2025 aus, wenn alle angedachten Maßnahmen zur Minderung des Zuflusses von Sulfat umgesetzt werden.