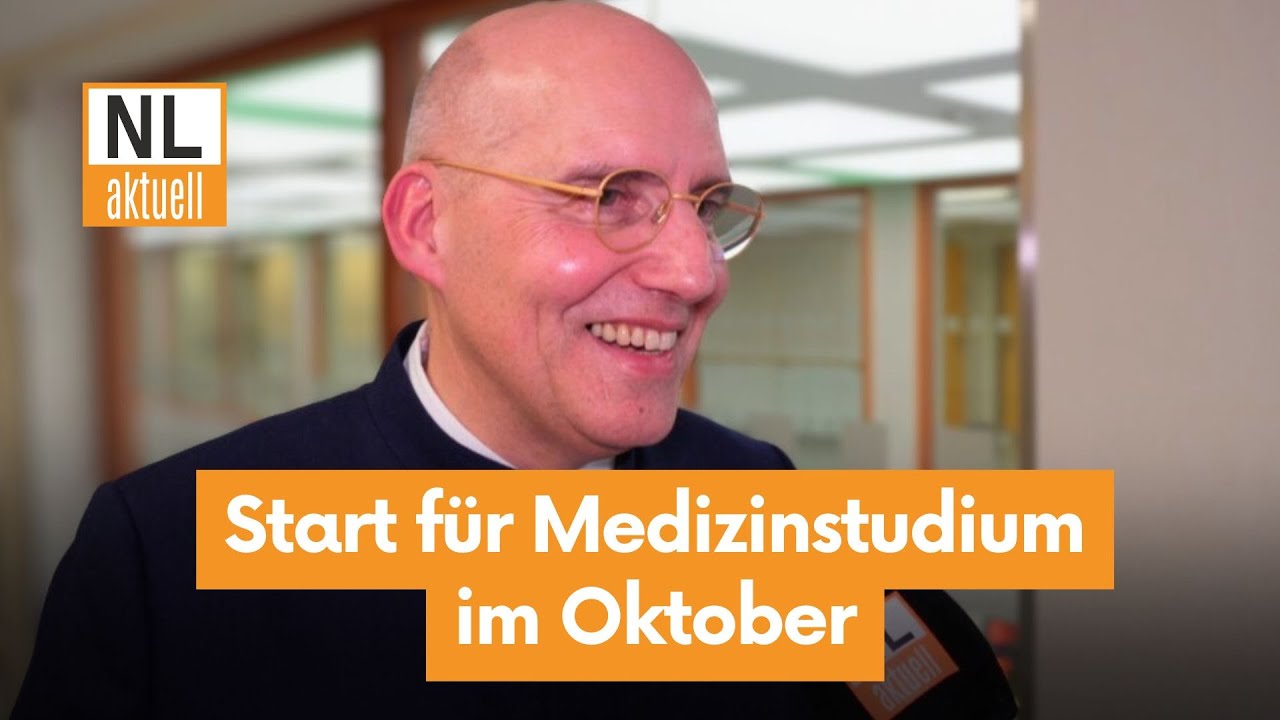Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid
Zum vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid (Kohlendioxid-Speicherungsgesetz – KSpG, DS 17/5750) nehme ich wie folgt Stellung:
Es ist unverantwortlich, Carbon Capture and Storage (CCS) im industriellem Maßstab einzuführen. Die CCS-Richtlinie der Europäischen Union (2009/31/EG) enthält keine Verpflichtung zur Anwendung des fragwürdigen Verfahrens. Vielmehr räumt die EU ihren Mitgliedern ein, CCS für das eigene Hoheitsgebiet auszuschließen.
Mit dem KSpG wird die großflächige CO2-Ablagerung von bis zu 8 Millionen Tonnen jährlich (§2, Abs. 2) in Tiefengesteinsschichten ermöglicht. Diese Menge entspricht einem Vielfachen dessen, was in bisherigen Forschungsprojekten erprobt wurde. Ein Großteil der Probleme der CO2-Verpressung ist längst nicht geklärt. Wohin wird das Tiefensalzwasser verdrängt? Können geologische Störungen (Verwerfungen, alte Bohrlöcher) in den Verpressungsgebieten mit endgültiger Sicherheit ausgeschlossen werden? Welchen Einfluss hat der enorme Druck auf die Gesteinsschichten und können sich daraus seismische Aktivitäten oder zusätzliche Leckagen ergeben?
Prozessbedingt werden die CO2-Ströme etwa 5% Schadstoffe enthalten (Vgl.: §24 Abs. 1). Diese Verbindungen, Schwefel- und Stickoxide, Staub, aber auch Lösungsmittelreste, summieren sich bei 3 Millionen Tonnen pro Verpressungsstandort auf 150.000 Tonnen nicht spezifizierte Giftstoffe jährlich. Es lässt sich kaum vorhersagen, wie sich diese Gemische auf Leitungen, Abdichtungen und poröse Gesteinsschichten, auf das Ökosystem Boden, unterhalb landwirtschaftlicher Flächen und unter dem Grundwasser, auswirken.
CCS leistet keinen Beitrag zum Klimaschutz. Die CCS-Projekte in Deutschland dienen der Umgehung des CO2-Emissionshandels bei der Braunkohleverstromung. Dadurch soll diese antiquierte Form der Energiegewinnung – träge, ineffizient und umweltbelastend – ins 21. Jahrhundert verlängert werden. Mit Einführung von CCS wird der Wirkungsgrad der Kohlekraftwerke um 10% sinken. Zusätzlicher Energiebedarf für Abscheidung, Transport, Verdichtung und Verpressung würden den Ressourcenverbrauch um mindestens 30% steigern. Gleichzeitig muss garantiert sein, dass die CO2-Endlager für 1.000 Jahre dicht halten.
Dazu kommt, dass die Lagerformationen im Untergrund äußerst begrenzt sind. Daraus ergeben sich zwangsläufig Nutzungskonkurrenzen, etwa mit Erdwärme oder Druckluftspeichern. CCS bindet Forschungsgelder und behindert den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien. CCS ist keine Brücke, sondern eine Sackgasse.
CCS dient nicht dem Allgemeinwohl, wie in §4 Abs. 5 vorausgesetzt wird, sondern den wirtschaftlichen Interessen von einigen wenigen Energiekonzernen. Außerdem ist es unverständlich, dass die Ewigkeitskosten für die Sicherung der Lager laut § 31 Abs. 1 nach nur 30 Jahren von der Allgemeinheit übernommen werden sollen.
Art. 20a des Grundgesetzes fordert uns auf, die natürlichen Lebensgrundlagen auch für nachfolgende Generationen zu schützen. Nach meinem Verständnis verletzt die Einführung der CCS-Technologie diesen Grundsatz und deshalb werde ich gegen das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz stimmen.
Quelle: Büro Hans-Georg von der Marwitz MdB
Nach Gewaltvorfällen: Stadt Cottbus & Land einigen sich auf Maßnahmen
Nach den Gewaltvorfällen an Cottbuser Schulen in Sachsendorf und einem Brandbrief von Eltern haben sich Stadt, das Brandenburger Innenministerium und...