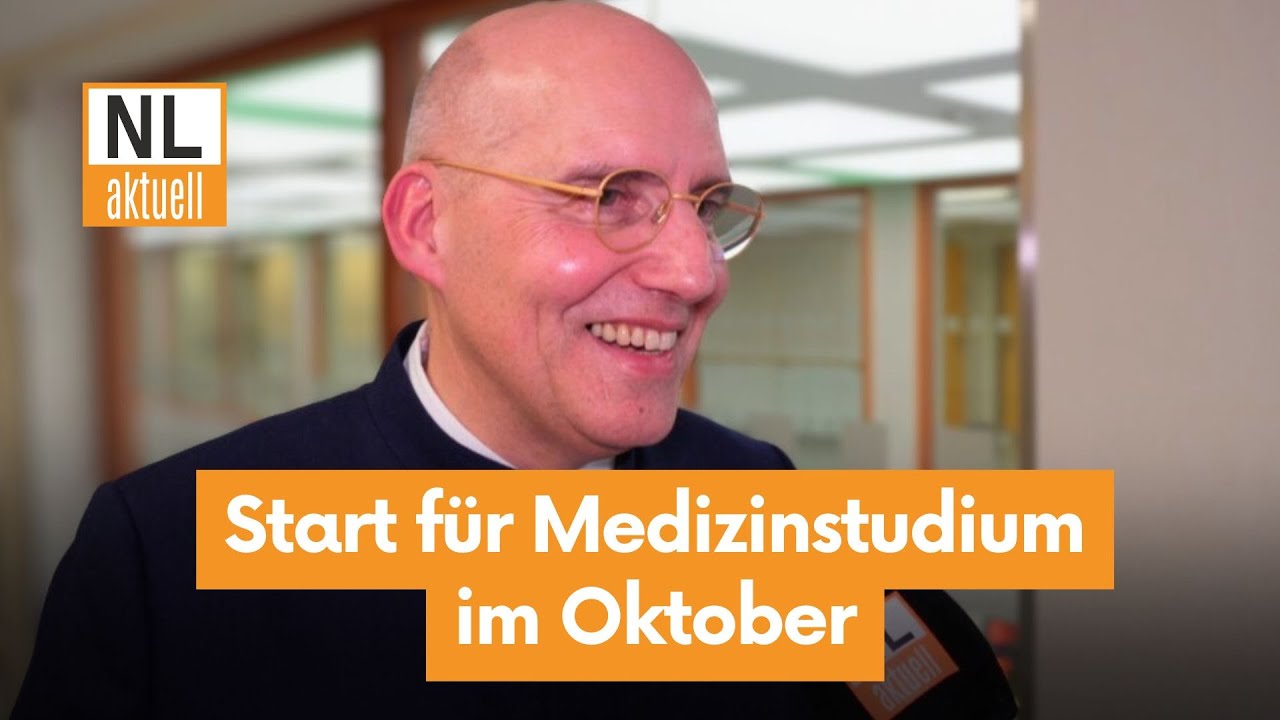Allen Erfolgsmeldungen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien zum Trotz ist Braunkohle noch immer mit Abstand wichtigste Quelle von Elektroenergie in Brandenburg (ca. 80%). Die meisten der in der Lausitz bestehenden Braunkohletagebaue werden jedoch in den kommenden 20 Jahren erschöpft sein. Um den Kraftwerksstandort langfristig zu sichern, sollen weitere Gebiete für den Bergbau freigegeben werden. Laut Stolpe sollte Horno das letzte Dorf sein, daß der Braunkohleförderung in Brandenburg geopfert wird. Doch es stehen Pläne im Raum, weitere Dörfer umzusiedeln.
Direkte Umweltschäden durch Tagebaue
Bei der Anlage von Tagebauen werden Vegetation und Gewässer großflächig komplett beseitigt und die Oberfläche bleibt über Jahre in diesem toten Zustand. Zudem muß aus das Wasser in großem Maßstab abgepumpt werden, um die Tagebaue trocken zu halten. Derzeit werden so etwa 230 Millionen m³ pro Jahr abgepumpt. Der Grundwasserspiegel wird so künstlich gesenkt und dadurch werden auch Feuchtgebiete, Flüsse und Seen in der weiteren Umgebung trockengelegt. Bäume, die bisher durch den Zugang zu Grundwasser Trockenperioden überstanden, können nun selbst bei kurzen Trockenheiten verdorren. Das abgepumpte Grundwasser muß zudem beseitigt werden und vergrößert den Abfluß der hierfür verwendeten Flüsse für Jahre auf ein unnatürlich hohes Maß. Bei der Rekultivierung wiederum werden den Flüssen diese Wassermengen wieder entzogen.
So muß der entstehende Cottbusser Ostsee ein Wasservolumen von 150.000.000 m³ aufgefüllt werden. Dies entspricht der gesamten Abflußmenge der Spree an der Mündung von fast 7 Wochen. Zwar werden die Tagebaue nach einigen Jahrzehnten wieder rekultiviert, es ist aber kaum vorstellbar, daß andere Wirtschaftszweige ähnliche Maßnahmen durchsetzen könnten. Braunkohletagebau wird also durch eine Sonderbehandlung im Umweltrecht privilegiert.
Soziale und ökonomische Schäden
Für die Erweiterung der Tagebaue werden Tausende Bürger enteignet und zwangsumgesiedelt. Für den Tagebau Jänschwalde Nord sind dies 900 Einwohner von Atterwasch, Grabko und Kerkwitz. Für Nochten rund 1.000 Einwohner von Rohne, Mulkwitz und Mühlrose. Für Welzow Süd sind es etwa 1.250 Einwohner der Ortseile Proschim und Lindenfeld.
Bei durchschnittlich 3 Einwohnern je Gebäude und Baukosten von 150.000 Euro je Wohnhaus ergeben sich Kosten von 150 Millionen Euro für die Umsiedlung. Weitere Kosten fallen für die Neuanlage der zerstörten Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen (Stromleitungen, Telefonleitungen, Straßen, Wasser, Abwasser…) an. Zwar werden diese finanziellen Konsequenzen von den Tagebaubetreibern ersetzt, jedoch kann der emotionale Verlust der Heimat schwer in Geld ausgedrückt werden. Die Preise werden nicht ausgehandelt, sondern festgelegt, und das in vielen Fällen zu Ungunsten der Anwohner. Denn wenn finanzielle Entschädigungen diesen Verlust kompensieren könnten, wäre kein Widerstand der Anwohner zu erwarten. Für andere Wirtschaftszweige wären derartige Enteignungen nicht möglich.
Auch die direkten Anlieger der Tagebaue werden für die Zerstörung ihres Wohnumfeldes und den damit einhergehenden Wertverlust ihrer Wohnhäuser nicht entschädigt. Sie haben zum Teil für Jahrzehnte Belästigung durch Lärm und Staub hinzunehmen.
Braunkohle wird jedoch durch eine Sonderbehandlung im Eigentumsrecht privilegiert. Es ist anders als bei der Steinkohle keine finanzielle Begünstigung auf Kosten der Steuerzahler, sondern eine Begünstigung auf Kosten der Eigentumsrechte und Lebensqualität der Anwohner.
Indirekte Schäden durch Klimawandel
Die Kraftwerke der Oberlausitz produzieren pro Jahr etwa 50 Millionen Tonnen CO2. Dieses trägt als Treibhausgas zur globalen Erwärmung bei. Es stellt sich die Frage, wie hoch der hierdurch je Tonne ausgelöste Schaden ist. Ginge man von den Zahlen von Greenpeace aus, liegt der Schaden je Tonne bei 205 Euro (verteilt über 40 Jahre), was externe Kosten des Braunkohletagebaus von rund 10 Milliarden Euro ergäbe. Jedoch sind diese angenommenen Werte offensichtlich übertrieben, denn laut dieser Berechnung müßte der jährliche Schaden durch den globalen CO2-Ausstoß der vergangenen 40 Jahre bereits bei mehreren Billionen Euro jährlich liegen. Diese Summe liegt erheblich über der Gesamtschadenssumme, die von klimatisch bedingte Naturkatastrophen herrührt. Und selbst diese Naturkatastrophen können dem Klimawandel nur zu einem kleinen Teil angerechnet werden. Schließlich sind Naturkatastrophen, lediglich Wahrscheinlichkeit und Stärke ändern sich durch den Klimawandel. Doch selbst nach den niedrigeren Schätzungen des Klimaskeptiker Richard Tol liegt der Schaden je Tonne CO2 bei rund 2 bis 10 Dollar je Tonne. Das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt geht von ähnlichen Werten aus und spricht von Schäden in Höhe von 2,4 € je Tonne CO2 über die nächsten 100 Jahre. Bei einem Ausstoß von 50 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr wären dies dennoch externe Kosten in Höhe von 120 Millionen Euro Jahr.
Kann CCS eine Lösung sein?
Seit einiger Zeit wird von den Betreibern der Braunkohletagebaue und –kraftwerke CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage) als Argument für eine langfristige Weiterführung der Braunkohlekraftwerke angeführt. Hierbei soll das CO2 aus den Abgasen ausgeschieden und unter Druck in unterirdische Formationen gepreßt werden. Ein Problem des Verfahren ist die unterirdische Lagerung der gewaltigen Mengen an CO2. Das Gas kann durch Spalten austreten, zudem kann es unerwünschte Wechselwirkungen mit dem Grundwasser geben. Ob sich diese Befürchtungen bestätigen soll in den nächsten Jahren in kleinen Feldversuchen geklärt werden. Zudem
ist unklar, ob die potentiellen Lagerstätten genügen, um langfristig anfallenden. Die
derzeit nachgewiesenen Lagerstätten genügen beim CO2-Ausstoß der deutschen
Braunkohlekraftwerke nur für einen Zeitraum von rund 30 Jahren.
Die Technologie befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Derzeit ist eine Pilotanlage geplant, die ab 2011 die Abgase einer 250 MW-Anlage reinigen soll. Dies entspräche nicht einmal 4% des Energieoutputs des Lausitzer Braunkohlereviers. Es ist nicht damit zu rechnen, daß die Technologie innerhalb des nächsten Jahrzehnts als Nachrüstsatz für den gesamten Kraftwerkspark im Revier eingesetzt wird.
Ein dritter Nachteil ist die Tatsache, daß CCS ein energieaufwendiges Verfahren ist, also ein Teil der produzierten Energiemenge wieder verbraucht wird. Da es bisher kaum großtechnische Umsetzungen des Konzeptes gibt, reichen die Schätzungen hierbei je nach Verfahren von nahezu vernachlässigbaren 3% bis hin zu 40% der vom Kraftwerk produzierten Energie. Dies bedeutet auch, daß für die gleiche Menge nutzbarer Energie mit CCS mehr Kohle und damit eine größere Tagebaufläche benötigt wird. Während die CCS das Problem der Treibhausgasemissionen drastisch verringern könnte, würden alle anderen Umwelt- und Sozialprobleme des Braunkohletagebaus nur noch verschlimmert werden. CSS macht aus Braunkohle keine saubere und umweltfreundliche Technologie und sollte daher auch nicht als Vorwand für eine langfristige Fortsetzung des Braunkohletagebaus benutzt werden.
Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen fordert die Landesregierung auf, ihre Position zur Braunkohle zu überdenken.
1. Langfristig sollte der Ausstieg aus der Braunkohleförderung bis Mitte des Jahrhunderts eingeplant werden.
2. CCS kann bestenfalls eine Übergangslösung sein, denn diese Technologie löst nur das Treibhausgasproblem, verschärft dabei aber die weiteren Probleme der Braunkohleförderung und schafft zudem das neue Problem der CO2-Endlagerung.
3. Die Abbaggerung weiterer Dörfer und die Enteignung tausender Bürger ist nicht akzeptabel. Wie Bagenz-Süd und Spremberg-Ost zeigen, können neue Tagebaue auch ohne Abbaggerung von Dörfern angelegt werden. Würde Jänschwalde Nord in der Größe beschränkt werden, würde auch bei diesem Tagebau die Abbaggerung der am Rand gelegenen Dörfer Atterwasch, Grabko und Kerkwitz unnötig.
4. Die Anwohner von Tagebauen sind von den Betreibern der Tagebaue angemessen für den Verlust an Wohnqualität bzw. den Wertverlust der Grundstücke zu entschädigen. Die Abwälzung derartig gravierender externer Kosten auf der Allgemeinheit ist nicht akzeptabel.
Quelle: Robert Soyka
Landespolitischer Sprecher für Umwelt und Naturschutz der Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen